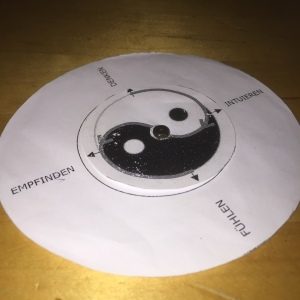Belastungen werden von unterschiedlichen Menschen auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Was hat es mit dem Thema „Psychische Belastungen am Arbeitsplatz“ tatsächlich auf sich – und wie kann damit umgegangen werden?
Belastungen durch die Arbeitsumstände (Menge, Zeitdruck etc.) werden von Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen und bewältigt.
Jeder Mitarbeiter entwickelt hierfür individuelle Strategien und handelt nach ihnen – meist intuitiv und beruhend auf Erfahrungen, die in früheren Lebensphasen gemacht wurden. Manche von ihnen sind in den aktuellen Situationen jedoch wenig nützlich oder führen nicht dazu, dass Stress adäquat bewältigt wird.
Die Folgen sind zunächst einfache Belastungssymptome, wie Konzentrationsschwierigkeiten, eine höhere Fehlerquote, Gereiztheit (z. B. im Kundenkontakt), Schlafstörungen, Grübelschleifen, Ängste etc. Allein das kann dem Unternehmen viel Geld kosten.
Noch teurer wird es, wenn diese Probleme ungelöst bleiben und zu langwierigen Krankschreibungen führen (z. B. wegen eines Burnouts).
Man könnte also sagen, wir haben uns in sehr frühen Jahren einen individuellen Umgang mit spezifischen Problemsituationen antrainiert – und verhalten uns heute noch meist mehr oder weniger gleich?
Ja, in etwa so könnte man es formulieren. In der frühen Kindheit lernt der Mensch sich fortzubewegen und auf seine Umwelt so zu reagieren, dass grundlegende Bedürfnisse befriedigt werden. Jene Bewegungsmuster, die funktionieren, werden abgespeichert und immer wieder angewendet.
Nach ein paar Wiederholungen lassen sie sich durch eine jeweils spezifische Verhaltens- bzw. Handlungsabsicht aktivieren und laufen dann wie von selbst ab, ohne dass sich das Kind weiterhin auf die Einzelbewegungen bzw. auf die Reihenfolge des Bewegungsablaufes konzentrieren muss.
Dieser Automatismus ermöglicht es ihm, seine Aufmerksamkeit auf (andere) Aspekte der Situation zu richten. So kann es etwas tun und gleichzeitig an etwas anderes denken. Das Wissen um die Einzelbewegungen gerät dann immer mehr in „Vergessenheit“ und wird meist nur noch unbewusst abgerufen.
Ähnlich verhält es sich auch mit komplexeren (sozialen) Verhaltensmustern. Hat ein Kind gelernt, was es tun muss, um ein bestimmtes Bedürfnis erfüllt zu bekommen oder Schmerz zu vermeiden, wird es immer wieder versuchen, mittels dieses Verhaltens erneut an sein Ziel zu gelangen.
Hat sich ein Verhaltensmuster im Laufe der ersten Lebensjahre als besonders hilfreich erwiesen, kann dies dazu führen, dass das entsprechende Muster übergeneralisiert und damit zu einem festen Bestandteil der Persönlichkeit wird, welches sich im weiteren Verlauf des Lebens störend auswirken und zu stetig wiederkehrenden Konflikten oder Schwierigkeiten führen kann.
Nun wissen – oder ahnen wir zumindest – welche fatalen Folgen ein nicht adäquater Umgang mit Belastungen nach sich ziehen kann. Doch welche Möglichkeiten gibt es in der Praxis, derartige Fehlentwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen – und vor allem zu verhindern?
Hierfür bietet es sich an, mittels gezielter Fragen herauszufinden, welche konkreten Arbeitsumstände von Mitarbeitern als belastend empfunden werden und wie sich diese auf ihr Leistungsvermögen auswirken.
Mittels lösungs- und ressourcenfokussierender Fragetechniken können anschließend individuelle Strategien für einen gesundheitsförderlichen Umgang mit den entsprechenden Stressoren entwickelt werden.
Manchmal können auch kleine Veränderungen in der Einstellung eines Mitarbeiters oder im Arbeitsablauf aus einer Belastung eine (leicht) zu bewältigende Aufgabe machen, und potenziell dazu beitragen, den Krankenstand zu reduzieren – zum Wohle aller Beteiligten.
In der praktischen Beratungsarbeit stoßen wir in vielen Unternehmen durchaus auf große Zustimmung, wenn es es darum geht, psychische Belastungen zu reduzieren. Gleichzeitig werden wir allerdings auch immer wieder mit der kritischen Frage konfrontiert wie sich so etwas wie psychische Belastung vernünftig messen lässt.
Seit August 2013 sind psychische Belastungen am Arbeitsplatz im Gefährdungskatalog nach §§ 5, 6 ArbSchG enthalten. Eine einfache und zugleich gute Möglichkeit, sich einen ersten Überblick über die Gefährdungsfaktoren im eigenen Betrieb zu verschaffen, bieten die Checklisten zur Erfassung von Fehlbeanspruchungen (ChEF) der (deutschen) Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Sie können im Internet kostenlos heruntergeladen und von den Mitarbeitern selbst ausgefüllt werden. Abgefragt werden darin die Kategorien „Stress“, „Psychische Ermüdung“, „Monotonie“ und „Psychische Sättigung“.
Fraglich ist allerdings gerade in kleineren Betrieben, wo die Anonymität einer solchen Befragung nur sehr bedingt gewährleistet werden kann, ob Mitarbeiter es tatsächlich offen zugeben würden, wenn sie sich durch die bestehenden Anforderungen „überlastet“ fühlen. Zudem bemerken viele Betroffene erst dann, dass sie den Belastungen nicht mehr gewachsen sind, wenn sie bereits am Ende ihrer Kräfte sind. Bis dahin ist es eher typisch, dass immer mehr Energie dafür aufgewendet wird, sich zusammenzureißen und gewisse Auffälligkeiten (wie z. B. eine erhöhte Fehlerquote, Schlafstörungen oder vermehrten Alkoholkonsum) zu beschönigen oder auszublenden.
Eine weitere Schwierigkeit dieser Art Fragebögen liegt darin, dass bei den darin benannten Faktoren nicht klar wird, warum diese überhaupt als Belastung empfunden werden. Nicht jeder potenzielle Stressor erzeugt schließlich bei jedem Menschen die gleiche Art von Stress!
Das Resilienz-Konzept geht davon aus, dass Menschen mit Belastungen unterschiedlich gut umgehen können. Die Energie, die dem Einzelnen dafür zur Verfügung steht, potenziellen Stressoren so zu begegnen, ohne dass die Leistungsfähigkeit oder die gesundheitliche Stabilität beeinträchtigt werden, ist im hohen Maße abhängig von individuellen Ressourcen, die sich u. a. aus der motivationalen Einstellung sowie aus der Ausprägung verschiedener Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen ergeben.
Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass je mehr die verschiedenen Anforderungen im Arbeitsalltag miteinander im Konflikt stehen, umso höher ist auch der Energieaufwand, der geleistet werden muss, um ihnen gerecht zu werden bzw. um in diesem Spannungsverhältnis bestehen zu können. Dieses (empfundene) Konfliktpotenzial lässt sich inzwischen relativ genau messen, z. B. mit dem vom ap Institut für Wirtschaftspsychologie entwickelten Mental-Screening.
Die Messergebnisse werden dabei mit den individuellen Ressourcen abgeglichen und geben Aufschluss darüber, wie ein Mitarbeiter individuell darin unterstützt werden kann, mit den bestehenden Anforderungen besser zurechtzukommen.
Was kann ein Unternehmen tun, das die klare Absicht hat, hier aktiv zu werden – Welches Vorgehen hat sich hier in der Praxis bereits bewährt?
Es gibt eine Vielzahl von Workshops und Seminaren zu diesem Thema. Wichtig ist es m. E., dass mit Beispielen oder Fällen aus der Praxis des jeweiligen Unternehmens gearbeitet und auf die speziellen Arbeitsbedingungen geschaut wird, da es kein Allheilmittel gegen psychische Belastungen gibt.
Zentral dabei ist vor allem die Haltung der Führungskräfte, d. h. wie es ihnen gelingt, auf ihre Mitarbeiter zuzugehen und sie bei Problemen gezielt zu unterstützen. Vorbehalte und Berührungsängste sollten diskutiert und ausgeräumt werden. Als Leitbild dient hierbei das HILFE-Konzept: Hinsehen, Initiative ergreifen, Leitungsfunktion wahrnehmen, Führungsverantwortung übernehmen (Fördern und Fordern) und im Bedarfsfall Experten hinzuziehen.
Auch die Frage, was „psychische Gesundheit“ überhaupt ist bzw. wie sie sich erhalten lässt, sollte erörtert werden.
Welche besonderen Erfahrungen machen Sie in Ihrer tagtäglichen Auseinandersetzung mit dem Thema als Psychologe?
Als Diplom-Psychologe und systemischer Coach unterstütze ich Unternehmen und Betroffene, wenn es darum geht, Wege zu finden, mit psychischen Belastungen und Stress umzugehen und/oder als Führungskraft darauf zu reagieren.
Die konkreten Themen in den Einzelgesprächen sind vielfältig. Mein Anliegen ist es, vor allem Menschen in Krisensituationen zu unterstützen, neue Perspektiven für sich zu entwickeln. Psychische Erkrankungen behandle ich nicht therapeutisch. Aber mein Wissen über sie und ihre Behandlungsmethoden hilft mir dabei, die Dringlichkeit eventuell erforderlicher oder den potenziellen Nutzen möglicher Schritte einzuschätzen und diese ggf. fachlich begründet vorzuschlagen.
Grundsätzlich habe ich ein sehr optimistisches (humanistisches) Menschenbild, d. h. dass ich davon ausgehe, dass persönliches Wachstum jederzeit für jeden möglich ist und wir die Lösung der meisten unserer Probleme in uns tragen. Dass auch die Rahmenbedingungen bzw. das System, in dem sich jemand bewegt, eine wesentliche Rolle spielt, steht dabei außer Frage.
Allerdings berate ich Unternehmen nicht dahingehend, wie sie strukturell gegen psychische Belastungen vorgehen sollten, und ich biete kein Konzept für ein BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) an.
Mein Fokus richtet sich darauf, wie Führungskräfte oder Teams ihre Situation wahrnehmen und wie es gelingen kann, einen adäquaten Umgang mit diesem Thema im Arbeitsalltag zu etablieren. In meinem Blog schreibe ich regelmäßig darüber und versuche, konkrete Hilfestellungen anzubieten.
Und wegen der Frage nach einem adäquaten Umgang engagieren Sie sich auch für das Thema „Mobbing“?
Psychosozialer Stress entsteht natürlich auch durch Konflikte. Wird daraus Mobbing, kann das zu schweren seelischen Verletzungen führen und der Schaden für das betroffene Unternehmen immens sein. Nicht allzu selten wird daraus eine Kostenspirale und endet mit dem Suizid eines (ehemaligen) Mitarbeiters oder Kollegen.
Seit März 2012 bemühe ich mich deshalb darum, im Rahmen der Moderation eines Forums zum Thema „Mobbing“ eine interdisziplinäre Vernetzung sowie einen fachlichen Austausch zu ermöglichen. Auf der Webseite www.fachforum-mobbing.de finden sich zudem umfangreiche Informationen und Unterstützungsangebote aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.
Selbst biete ich akut Betroffenen allerdings keine Beratung an, sondern verweise ggf. auf entsprechende Vereine oder Organisationen.
Als Diplom-Psychologe und systemischer Coach ist Rainer Müller seit über zwölf Jahren als Dozent, Trainer und Berater für verschiedene Institute bzw. Einrichtungen und Unternehmen tätig. Schwerpunkte seiner Arbeit sind der Umgang mit psychischen Belastungen sowie die Krisenintervention. Viele Jahre war er mit der beruflichen Wiedereingliederung von Menschen mit einer chronischen oder schweren psychischen Erkrankung bzw. Schwerbehinderung beim Integrationsfachdienst sowie im Rahmen der beruflichen Rehabilitation betraut. Seit 2006 unterrichtet er verschiedene Grundlagenfächer der Psychologie und psychotherapeutische Verfahren.
Kontakt:
Rainer Müller, Burchardstraße 20, 20095 Hamburg
Tel +49 175 1503935
Web:
www.psyche-und-arbeit.de
www.fachforum-mobbing.de